15-Minuten-Stadt: Deutschland weiter als gedacht
Die 15-Minuten-Stadt ist ein stadtstrukturelles Modell, das sich dadurch auszeichnet, dass möglichst viele Alltagsziele in maximal einer Viertelstunde zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar sind. Das Modell ist in Deutschland bereits deutlich verbreiteter als angenommen. Das zeigt eine neue Studie vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Auftrag des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.
Die Studie überprüfte alle deutschen Kommunen einheitlich auf die Erreichbarkeit 24 typischer Einrichtungen des täglichen Lebens, wie zum Beispiel Supermärkte, Schulen, Arztpraxen, Spielplätze, Grünanlagen, Gastronomie, Schwimmbäder und ÖPNV-Haltestellen. Um die Erreichbarkeit zu ermitteln, wurde auf der Grundlage der durchschnittlichen Gehgeschwindigkeit eines Erwachsenen gerechnet. Abweichungen vom Durchschnitt, wie sie zum Beispiel bei älteren Menschen oder Kindern vorliegen, wurden ebenfalls berücksichtigt. Für Ziele, die typischerweise weniger häufig aufgesucht werden, wurde mit der durchschnittlichen Geschwindigkeit mit dem Fahrrad gerechnet.
Das Ergebnis: die 15-Minuten-Stadt ist in vielen Kommunen in Deutschland bereits Realität, und das in Klein-, Mittel- und Großstädten. Im Durchschnitt sind 75% der Einrichtungen in 15 Minuten erreichbar. In den besten Städten liegen die Ziele durchschnittlich sogar nur 6 bis 8 Minuten entfernt.
Von Quartieren mit guter Nahversorgung profitieren Menschen unterschiedlicher sozialer Herkunft. Die Sorge, dass gute Erreichbarkeit zur Verdrängung einkommensschwächerer Haushalte führt, habe sich nicht bestätigt, so Dr. Brigitte Adam vom BBSR.
Die 15-Minuten-Stadt sei mehr als nur ein planerisches Ideal. Sie biete konkrete Antworten auf aktuelle Herausforderungen der Stadtentwicklung, erleichtere den Alltag durch kurze Wege, stärke Nachbarschaften und mache Quartiere lebendiger. Gleichzeitig verbessere sie die Lebensqualität, entlaste die Umwelt und fördere Klimaschutz.
Damit sich Menschen häufiger zu Fuß und mit dem Rad fortbewegen, braucht es allerdings eine Verbesserung der aktuellen Bedingungen. Die BBSR-Studie liefert dafür Empfehlungen, die ohne neue Gesetze und große Umbauprogramme umsetzbar sind – entscheidend dafür ist die Zusammenarbeit von Verkehrs- und Stadtplanung. Mögliche Maßnahmen sind zum Beispiel das Fördern der Nachverdichtung und Nutzungsmischung in locker bebauten Wohngebieten, das Verbessern der Infrastruktur für aktive Mobilität beispielsweise durch sicherere Radwege und weniger Barrieren, aber auch das Stärken der Kommunikation: Es gilt, Bürger*innen einzubinden, Bedarfe vor Ort zu klären und Ängsten entgegenzutreten. Dadurch können Schritte in Richtung einer grüneren, gesünderen und lebenswerteren Stadt getan werden.

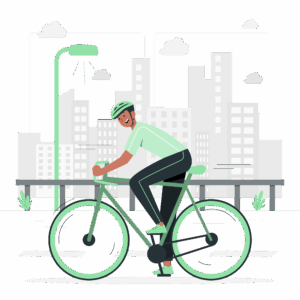

 Stadt Köln/tippingspoints GmbH
Stadt Köln/tippingspoints GmbH Unsplash/Buddy An
Unsplash/Buddy An